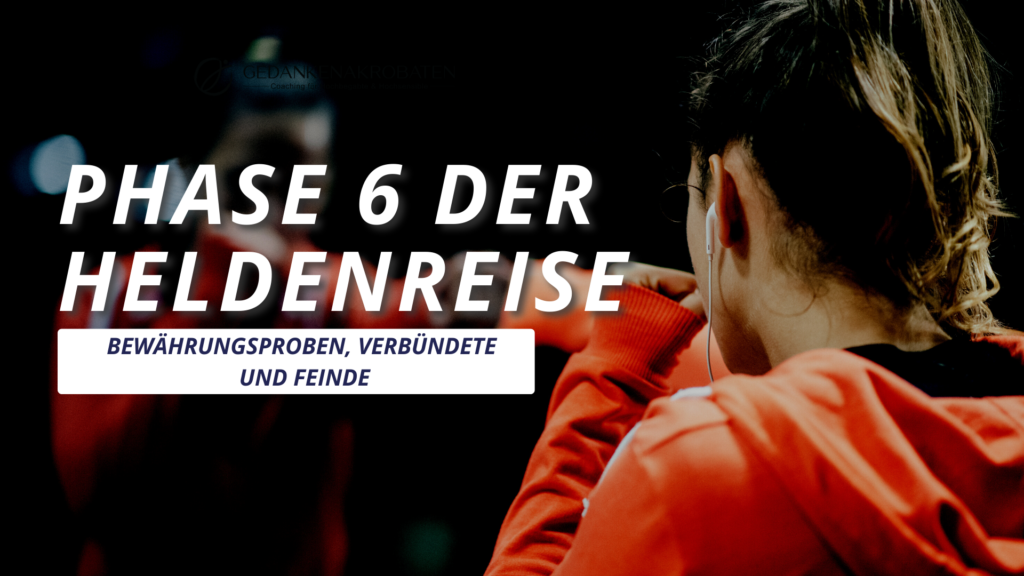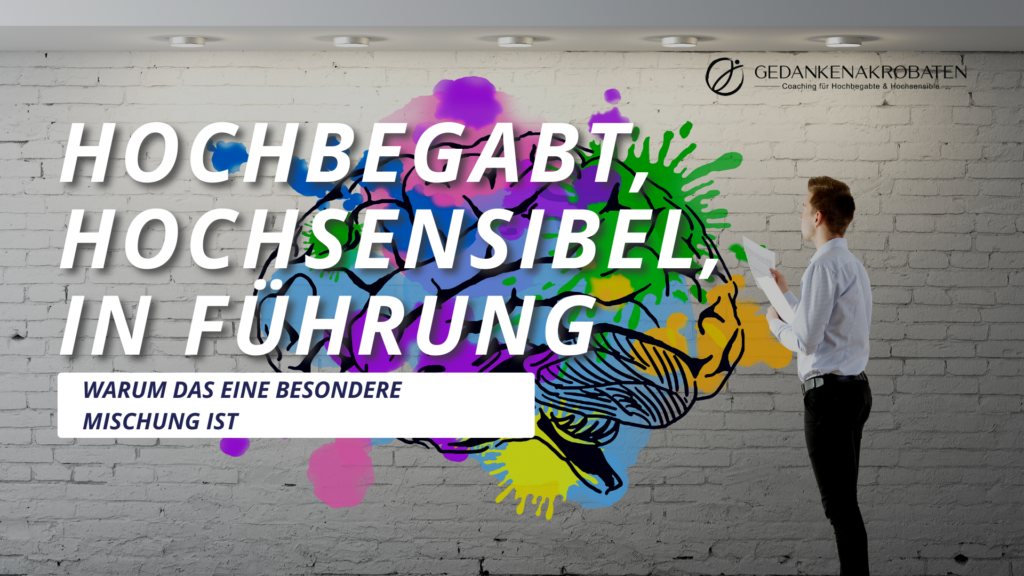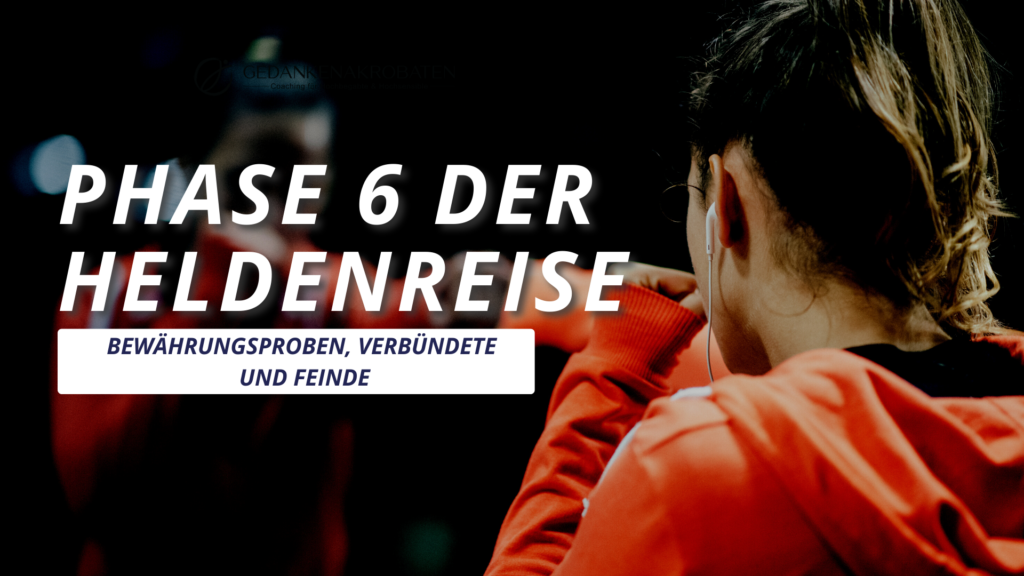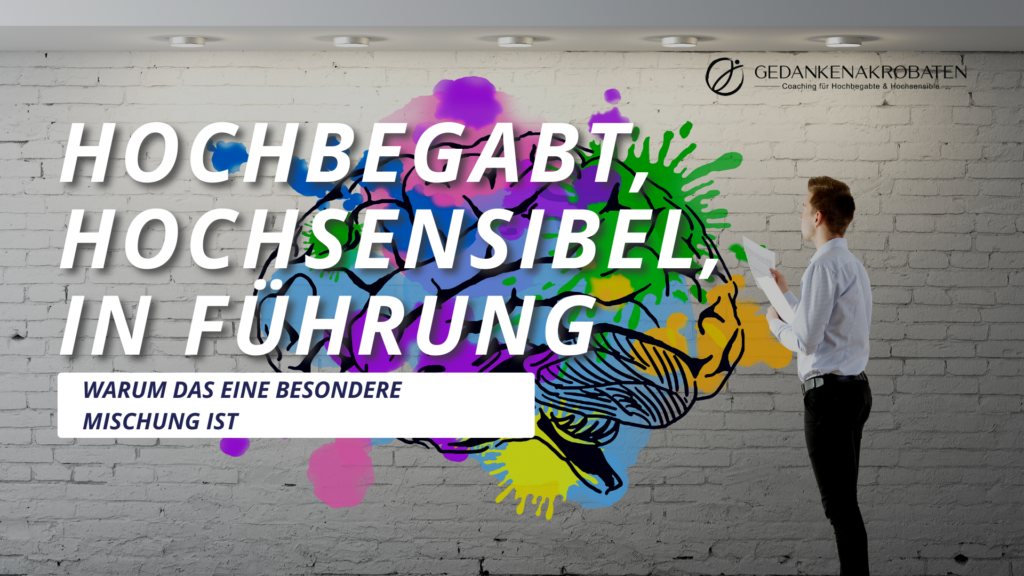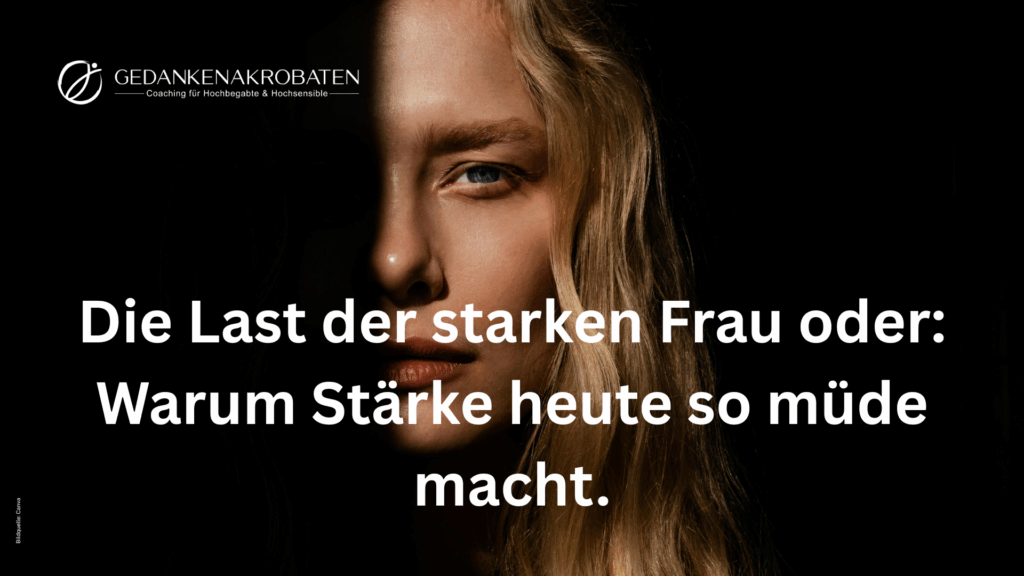
Die Last der starken Frau oder: Warum Stärke heute so müde macht
Die unbequeme Wahrheit
Neulich las ich in der WELT:
„Bleiben starke Frauen länger Single?“
Der Artikel listet die üblichen Verdächtigen auf: erfolgreiche, kluge, unabhängige Frauen, die „trotz allem“ allein sind.
Es geht um die, die „alles haben“ und doch keinen Partner finden.
Die Diagnose: zu wählerisch, zu emanzipiert, zu unabhängig.
Ich habe mich gefragt, warum dieses Narrativ immer noch funktioniert.
2025. Nach #MeToo, nach 40 Jahren Gleichberechtigungsdebatte, nach Millionen Frauen, die längst bewiesen haben, dass Stärke und Liebe sich nicht ausschließen.
Vielleicht liegt es daran, dass „die starke Frau“ nie wirklich gemeint war.
Vielleicht war sie immer nur eine gut verpackte Zumutung.
Teil 1: Was wir meinen, wenn wir „starke Frau“ sagen
„Starke Frau“ – das klingt nach Kompliment.
Nach Bewunderung.
Nach Applaus.
Aber unter der Oberfläche steckt oft eine unausgesprochene Botschaft:
„Du bist anders. Und das irritiert uns.“
Denn stark heißt in dieser Erzählung selten: klarsichtig, integrativ, reflektiert.
Sondern: belastbar, durchsetzungsfähig, schlagfertg (lass dir diesen Begriff mal auf der Zung zergehen…).
Ich kenne viele Frauen, die so beschrieben werden.
Sie haben Führungsverantwortung, Kinder, Beziehungen, Projekte, engagieren sich.
Und sie tragen das alles vermeinlich ohne Drama, ohne Klagen, ohne dass jemand merkt, wie schwer es geworden ist.
Aber wenn du mit ihnen sprichst, hörst du nicht:
„Ich muss funktionieren.“ oder “Ich hab keine andere Wahl.”
Sondern:
„Ich bin müde.”, “Ich bin erschöpft.”. “Ich bin desillusioniert.” “Ich weiß, dass ich in einem System hänge, das mich ständig aufreibt und ich versuche gerade, es zu durchschauen, zu biegen, zu nutzen, ohne daran kaputtzugehen.“
Das sind keine Opfer.
Das sind Strateginnen.
Sie sind erschöpft, ja, aber nicht blind.
Sie wissen und fühlen intensiv, wie Macht, Verantwortung, Loyalität und Schuld miteinander verstrickt sind.
Und sie suchen einen Weg, nicht härter zu werden, um zu überleben, sondern bewusster.
Theorie-Exkurs: Stärke ist kein Persönlichkeitsmerkmal, sondern ein Überlebensmodus
Wir verwechseln oft Stärke mit Charakter.
Tatsächlich ist sie häufig eine Strategie.
Ein psychologisch funktionales Schutzsystem, das sagt:
„Wenn ich alles allein hinkriege, bin ich sicher.“
Aus Sicht des Motivkompasses (Eilert):
Viele dieser Frauen bewegen sich im roten Feld: Gestaltung, Leistung, Kontrolle und haben gelernt, dort zu überleben.
Aber ihr eigentliches Gleichgewicht liegt in der Mitte zwischen Rot (Selbstbestimmung) und Grün (Verbindung).
Sie haben sich Stärke angewöhnt, um Unabhängigkeit zu bewahren.
Aber ihr Herz sehnt sich längst nach Kooperation, Resonanz, Nachsicht – auch mit sich selbst.
Das Problem:
Unsere Kultur belohnt die Überlebensform, nicht die Heilungsform.
Sie feiert Disziplin, Selbstbeherrschung, Durchhaltevermögen und übersieht dabei, dass echte Stärke manchmal in Tränen, Rückzug und „Ich kann nicht mehr“ liegt.
Teil 2: Zwischen Mut und Müdigkeit: die Realität starker Frauen
Wenn ich an die Frauen denke, die mich umgeben, dann sind sie nicht stark, trotzdem sie müde sind.
Sie sind stark, weil sie müde sind und trotzdem nicht zynisch geworden sind.
Sie tragen Systeme, die ihnen keine Pause gönnen.
Sie halten Familien, Teams, Unternehmen zusammen.
Und sie wissen: Es ist nicht fair.
Aber sie kapitulieren nicht – jedenfalls nicht lange.
Sie versuchen, diese Systeme für sich zu nutzen, ohne sich selbst zu verraten.
Sie setzen Grenzen, wo andere Rücksicht erwarten.
Sie nehmen Pausen, obwohl der Kalender Nein sagt.
Sie stellen unbequeme Fragen.
Sie sagen Nein, wenn sie Ja meinen sollten.
Und sie sagen Ja zu sich, obwohl die Welt es ihnen übelnimmt.
Diese Frauen sind nicht hart.
Sie sind hellwach.
Und sie sind müde, weil sie die Diskrepanz sehen zwischen Anspruch und Realität, zwischen dem, was sie leisten, und dem, was sie dafür zurückbekommen.
Teil 3: Wenn andere mich stark nennen
„Du bist so stark.“
Das höre ich oft.
Aber selten fühlt es sich nach einem Kompliment an.
Eher nach Distanz.
Nach einem höflichen: „Du brauchst ja nichts. Du hast ja alles.“
Es ist ein Etikett, das Bewunderung und Überforderung zugleich ausdrückt.
Als würde man sagen:
„Du machst Eindruck auf uns, aber diese irritiert.”
Früher habe ich darauf so reagiert:
Ich hab mich angepasst, netter gemacht, Ideen zurückgehalten, Begeisterung gedrosselt, weniger gewollt.
Was für ein Bullshit.
Heute weiß ich:
Stark sein heißt nicht, alles allein zu schaffen (die Umsetzung übe ich noch…).
Es heißt, sich selbst treu zu bleiben, auch wenn andere sich abwenden.
Und es heißt, das Risiko einzugehen, gesehen zu werden, nicht nur als stark, sondern als Mensch.
Reflexionsfragen für dich
Wann nennst du eine Frau „stark“ und was meinst du damit wirklich?
Wie oft belohnst du dich selbst für „Funktionieren“ statt für „Fühlen“?
Was würde passieren, wenn du nicht stark wärst, sondern ehrlich?
Wer profitiert eigentlich davon, dass du alles im Griff hast?
Fazit
Die starke Frau, über die die WELT schreibt, ist kein Einzelfall.
Sie ist ein Symptom.
Für Systeme, die Frauen fordern, aber selten fördern.
Für eine Gesellschaft, die Stärke feiert, aber Nähe verlernt hat.
Und für das Missverständnis, dass Autonomie das Gegenteil von Liebe sei.
Vielleicht ist wahre Stärke das Gegenteil von dem, was wir glauben:
Nicht die Fähigkeit, alles zu schaffen,
sondern die Bereitschaft, weich zu bleiben, auch wenn’s unbequem wird.
Outro
Führung beginnt da, wo es unbequem wird. Genau dort fängt Wirkung an. Deine Kristin von #Gedankenakrobaten 🦊